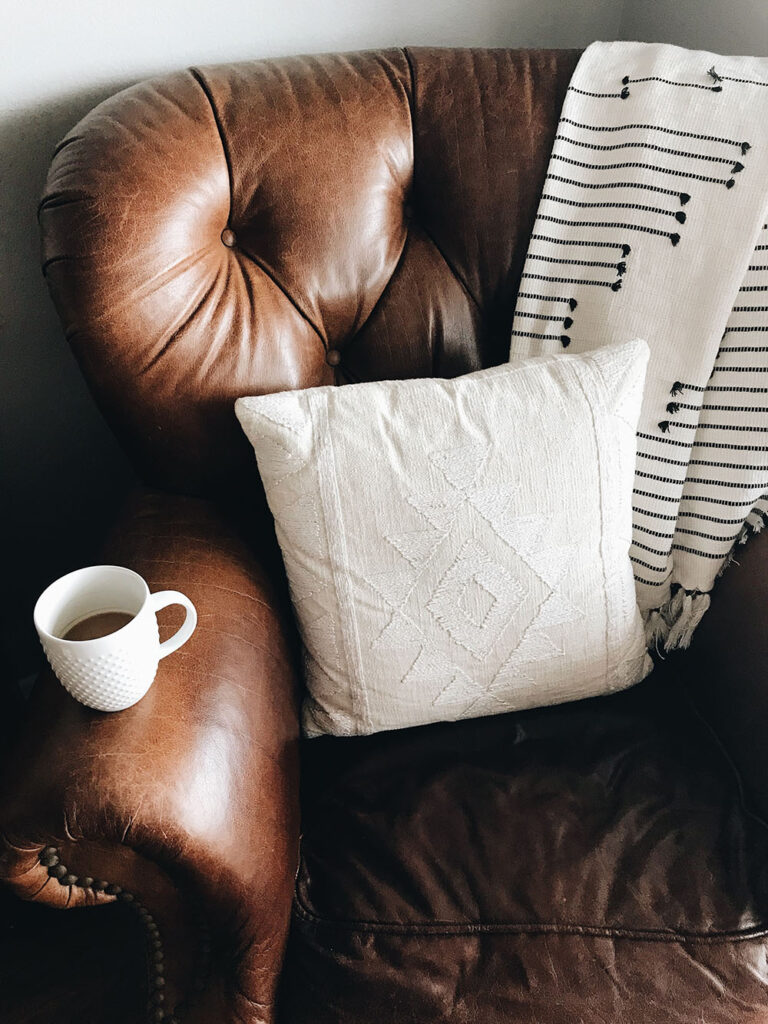
Gut informiert – Psychotherapie für Kinder und Jugendliche
Die folgenden Beiträge bieten einen Überblick zu häufigen Fragen und Herausforderungen rund um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
Mythen und Missverständnisse über Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie: „Mein Kind ist doch nicht ‚krank‘" – warum ein Gespräch mit einer Fachperson oft mehr bewirkt, als viele denken.
„Braucht mein Kind wirklich eine Therapie?“ – Diese Frage höre ich in meiner Privatpraxis oft von Eltern, die sich Sorgen machen, ob mit ihrem Kind „etwas nicht stimmt“. Dabei geht es in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie selten um „Kranksein“, sondern vielmehr darum, Kinder und Jugendliche in herausfordernden Situationen zu unterstützen. In diesem Beitrag räume ich mit den häufigsten Mythen auf und zeige, warum ein offenes Gespräch der erste Schritt zu mehr Leichtigkeit sein kann.
Mythos 1: „Nur kranke Kinder gehen in Therapie.“
Ein sehr verbreiteter Irrglaube ist, dass nur „psychisch kranke“ Kinder eine Therapie benötigen. Tatsächlich erleben viele Kinder im Laufe ihres Lebens Herausforderungen, die sie (und ihre Eltern) vorübergehend überfordern können: Schulprobleme, die Trennung der Eltern, soziale Unsicherheiten, Ängste oder Verhaltensauffälligkeiten sind keine Seltenheit. Die Forschung zeigt, dass Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter nachweislich positive Effekte auf die soziale, emotionale und verhaltensbezogene Entwicklung hat. Döpfner und Lehmkuhl (2002) fassen es treffend zusammen, wenn sie feststellen, dass psychodynamische Verfahren „nachhaltig Ressourcen stärken und Selbstwirksamkeit fördern“ und dies mit Effektstärken im mittleren bis hohen Bereich. Es geht also weniger darum, ob ein Kind „krank“ ist, sondern vielmehr darum, sein emotionales Wohlbefinden zu unterstützen und bei der Bewältigung aktueller Schwierigkeiten zu helfen.
Mythos 2: „Ein Gespräch mit Freunden oder in der Familie reicht doch aus.“
Ein liebevolles Umfeld und offene Gespräche sind wichtige Stützen für Kinder und Jugendliche. Dennoch bietet die therapeutische Arbeit darüber hinaus einen besonderen geschützten Raum, in dem Kinder ihre Gefühle und Erfahrungen ausdrücken können – oft Dinge, die im familiären Umfeld schwer ansprechbar sind. Fonagy und Target (2007) betonen, dass genau diese therapeutische Beziehung „ein vertieftes Erleben“ schafft, das eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Veränderungen ist. Professionelle Psychotherapie ergänzt somit die innerfamiliären Gespräche um das Verstehen und Bearbeiten tieferliegender Ursachen.
Mythos 3: „Therapie dauert ewig und bringt sowieso nichts.“
Dieses Bild von endlosen, ineffektiven Therapien entspricht nicht der Realität. Sowohl meine Praxiserfahrung als auch die Forschung zeigen, dass Therapien individuell gestaltet werden und häufig schon nach wenigen Sitzungen erste positive Entwicklungen sichtbar werden. Besonders Kurzzeittherapien haben sich hier als wirksam erwiesen. Weisz et al. (2011) unterstreichen, dass Therapie keineswegs ein „endloser Prozess“ sein muss, sondern gezielt auf die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie abgestimmt wird. Dadurch kann oft recht schnell eine Verbesserung des Wohlbefindens erreicht werden – was viele Familien als sehr erleichternd erleben.
Mythos 4: „Über Probleme zu sprechen macht alles schlimmer.“
Ganz im Gegenteil: Das Vermeiden oder Verschweigen belastender Themen kann diese häufig sogar verstärken. Ein behutsamer, professioneller Umgang mit schwierigen Gefühlen und Erfahrungen in der therapeutischen Beziehung ermöglicht Kindern und Jugendlichen, belastende Themen zu ordnen und besser zu verstehen. Dies führt oft bereits zu großer Erleichterung und ist häufig der erste Schritt hin zu einer positiven Veränderung.
Ein offenes Gespräch – der erste Schritt
Elternschaft ist herausfordernd, und es gehört viel Mut dazu, sich Unterstützung zu holen. Ein unverbindliches Erstgespräch in meiner Praxis kann klären, ob und wie eine Therapie helfen kann – oft genügt bereits dieses Gespräch, um den nächsten Schritt zu erkennen. Mir ist es wichtig, Sie und Ihr Kind respektvoll und wertschätzend zu begleiten – ohne Vorurteile oder Schubladendenken.
Wenn Sie unsicher sind, ob Psychotherapie für Ihr Kind der richtige Weg ist, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich berate Sie und unterstütze Sie dabei, die beste Entscheidung für Ihre Familie zu treffen.
Herzlichst,
E. Salmaier
Quellenverzeichnis
- Döpfner, M., & Lehmkuhl, G. (2002). Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie: Grundlagen, Verfahren und Evidenz. Hogrefe.
- Fonagy, P., & Target, M. (2007). Attachment and psychoanalytic clinical practice. Routledge.
- Weisz, J. R., Jensen-Doss, A., & Hawley, K. M. (2011). Evidence-based psychotherapies for children and adolescents. The Guilford Press.
Wann ist Psychotherapie für Kinder und Jugendliche sinnvoll?
Eltern sind oft unsicher, ab wann bei ihrem Kind oder Jugendlichen professionelle psychotherapeutische Unterstützung notwendig ist. Kindheit und Jugend sind Phasen großer körperlicher, emotionaler und sozialer Veränderungen – es ist ganz normal, dass Kinder gelegentlich Krisen oder belastende Phasen durchlaufen. Doch wann deuten Symptome darauf hin, dass eine Psychotherapie hilfreich und notwendig sein kann?
Typische Anzeichen für psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen
Bis zu 20 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zeigen im Verlauf ihrer Entwicklung psychische Auffälligkeiten, die eine Behandlung erfordern können (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA], o. J.). Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind dabei oft mit erheblichen Belastungen für die gesamte Familie verbunden und benötigen deshalb eine frühzeitige und zielgerichtete Intervention (Weltgesundheitsorganisation [WHO], 2022).
Typische Anzeichen können sein:
- Anhaltende Traurigkeit oder gedrückte Stimmung, die über Wochen anhält; bei Kindern kann sich das auch als Reizbarkeit oder Aggressivität äußern.
- Rückzug von Freunden, Familie und bekannten Aktivitäten, Verlust des Interesses an Hobbys, Spielen oder der Schule.
- Leistungsabfall in der Schule durch Konzentrationsstörungen und verminderte Motivation.
- Verändertes Ess- und Schlafverhalten, z. B. Schlaflosigkeit, übermäßiges Schlafen, Appetitverlust oder -zunahme.
- Psychosomatische Beschwerden wie wiederkehrende Bauch- oder Kopfschmerzen ohne organische Ursache.
- Ängste vor sozialen Situationen, Schulangst oder generalisierte Sorgen, die sehr belastend sind.
- Verhaltensauffälligkeiten wie übermäßige Unruhe, starke Wutausbrüche oder aggressives Verhalten.
- Selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken, die schnelle professionelle Hilfe erfordern.
Auch wenn einzelne dieser Symptome vorübergehend auftreten können, ist es wichtig, sie ernst zu nehmen, wenn sie über Wochen anhalten, sich verschlimmern oder das Kind/den Jugendlichen in seiner Alltagsbewältigung stark einschränken.
Wann sollte man psychotherapeutische Hilfe suchen?
Eine frühzeitige psychotherapeutische Behandlung kann die Entwicklung positiver Bewältigungsstrategien fördern und die Wahrscheinlichkeit chronischer Störungen im Erwachsenenalter verringern (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie [DGKJP], 2021).
Eltern sollten professionelle Unterstützung insbesondere dann in Anspruch nehmen, wenn
- Veränderungen im Verhalten oder der Stimmung „ohne erkennbaren Grund“ deutlich ausgeprägt sind
- familiäre Krisen, wie Trennung, Todesfall oder Krankheit, das Kind stark überfordern
- Lehrer, Erzieher oder andere Bezugspersonen die Probleme bemerken und sich Sorgen machen
- das Kind selbst oder die Eltern durch das Verhalten und die Symptome stark belastet sind
Eltern sind außerdem die wichtigsten frühen Erkennungspersonen: Werden auffällige Verhaltensweisen konsequent beobachtet und ernst genommen, können sie den Zugang zu hilfreicher Unterstützung ermöglichen (Kölch, 2020).
Warum Psychotherapie sinnvoll ist
Psychodynamische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie hilft, die inneren Konflikte, Gefühle und Erfahrungen zu verstehen, die das Kind belasten. Kinder zeigen oft Symptome, die Ausdruck unverarbeiteter Ängste, Verluste oder Beziehungserfahrungen sind. Die Therapie bietet einen sicheren Rahmen, in dem Kinder und Jugendliche ihre Gefühle ausdrücken und ihre Ressourcen zur Bewältigung stärken können.
Eine therapeutische Begleitung unterstützt junge Menschen zudem dabei, ihre Gefühle besser zu verstehen und zu regulieren – das ist eine wesentliche Grundlage für ein stabiles Selbstbild und gesunde soziale Beziehungen. Insgesamt trägt Psychotherapie dazu bei, Entwicklungskrisen zu überwinden und die Resilienz zu stärken (DGKJP, 2021).
Psychotherapie ist keine Schwäche, sondern eine wichtige Unterstützung zur gesunden Entwicklung, wenn das Kind oder der Jugendliche sich allein mit belastenden Emotionen oder Problemen überfordert fühlt.
Sind Sie unsicher, ob Ihr Kind Hilfe braucht?
Als erfahrene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin begleite ich Familien in solchen Fragen. In einem persönlichen Gespräch können wir gemeinsam herausfinden, ob eine psychotherapeutische Unterstützung für Ihr Kind sinnvoll ist. Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.
Herzlichst,
E. Salmaier
Quellenverzeichnis:
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (o. ).Psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. https://www.bzga.de
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. (2021). Leitlinien zur Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter.
- Kölch, M. (2020). Früherkennung psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen PsychotherapeutenVereinigung.
- (2022). Mental health of children and adolescents. https://www.who.int
Umgang mit Krisensituationen: Was tun bei Schulverweigerung, Essstörungen und Trauerfällen?
Als Eltern möchten Sie Ihr Kind bestmöglich unterstützen – gerade in schwierigen Lebensphasen. Krisensituationen wie Schulverweigerung, Essstörungen oder der Umgang mit Trauer sind oft emotional belastend und können Unsicherheit auslösen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Kind liebevoll begleiten können und wann professionelle Hilfe erforderlich ist.
Schulverweigerung – wenn der Schulweg zur großen Hürde wird
Wenn Ihr Kind sich weigert, zur Schule zu gehen, fühlen Sie sich vielleicht ratlos oder sogar hilflos. Schulverweigerung ist häufig ein Ausdruck von tieferliegenden Ängsten, Überforderung oder Konflikten – sei es in der Schule, im Freundeskreis oder zu Hause. Die renommierte Kinderpsychologin Prof. Dr. Brigitte Spreckelsen schreibt dazu:
„Schulverweigerung ist niemals einfach ‚Faulheit‘, sondern spiegelt oft die verzweifelte Suche eines Kindes nach Stabilität und Eigenbestimmung wider. Verständnis und Unterstützung sind wichtiger als Druck“ (Spreckelsen, 2017, S. 42).
Als Eltern können Sie Ihrem Kind Sicherheit vermitteln, indem Sie offen und ohne Vorwürfe zuhören. Gemeinsam mit Schule und gegebenenfalls einer erfahrenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin können individuelle Lösungen gefunden werden.
Essstörungen – wenn Essen zur Belastung wird
Essstörungen sind mehr als ein Essverhalten – sie sind Ausdruck seelischer Not und eines gestörten Verhältnisses zum eigenen Körper. Gerade Eltern erleben hier oft große Sorge um das Wohl ihres Kindes, verbunden mit Verzweiflung und Unsicherheit im Umgang damit. Prof. Dr. Thomas Fichter, Experte für Essstörungen, stellt klar:
„Essstörungen sind komplexe Erkrankungen, die eine ganzheitliche Behandlung erfordern. Die Mitarbeit und Unterstützung der Familie ist dabei ein entscheidender Faktor für den Therapieerfolg“ (Fichter, 2019, S. 105).
Als Eltern sollten Sie erste Anzeichen ernst nehmen, Ihr Kind liebevoll begleiten und frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Trauerfälle – gemeinsam durch schwere Zeiten gehen
Der Verlust einer nahestehenden Person trifft Kinder und Jugendliche tief. Trauer kann unterschiedlich erlebt werden: Manche ziehen sich zurück, andere zeigen Wut oder Verwirrung. Die Trauerforscherin Prof. Dr. Claudia Michels erklärt:
„Kinder brauchen in ihrer Trauer vor allem eine sichere Bindungsperson, die zuhört und ihre Gefühle annimmt. Rituale und offene Gespräche helfen dabei, den Schmerz zu verarbeiten“ (Michels, 2018, S. 77).
Seien Sie präsent, erlauben Sie Ihrem Kind alle Gefühle und scheuen Sie sich nicht, externe Unterstützung zu suchen, wenn die Trauer das Familienleben stark belastet.
Fazit für Eltern
Krisensituationen wie Schulverweigerung, Essstörungen oder Trauer fordern von Ihnen als Eltern viel Kraft. Sie sind jedoch weder allein noch machtlos. Verständnis, Geduld und der Mut, sich Unterstützung zu holen, sind wichtige Schritte, um Ihr Kind durch diese Zeiten zu begleiten. Psychodynamische Therapie und enge Zusammenarbeit mit Schule und Fachkräften bieten einen tragfähigen Rahmen für Heilung und Entwicklung.
Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung wünschen, stehe ich Ihnen gern als erfahrene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin zur Seite. Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.
Herzlichst,
E. Salmaier
Quellenverzeichnis
- Fichter, T. (2019). Essstörungen: Diagnostik und Therapie(3. Aufl.). Springer.
- Michels, C. (2018). Trauer bei Kindern und Jugendlichen(1. Aufl.). Hogrefe Verlag.
- Spreckelsen, B. (2017). Kindliche Krisen verstehen(2. Aufl.). Beltz Verlag.
Konzentrationsschwierigkeiten oder ADHS? Wie Sie - als Eltern - den Unterschied erkennen
Wenn Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, macht sich das oft schnell im Schulalltag und zu Hause bemerkbar. Ihr Kind wirkt vielleicht schnell abgelenkt, erledigt Aufgaben nur langsam oder verliert schnell die Motivation. Als Eltern fragen Sie sich: Handelt es sich um eine vorübergehende Phase, um reine Konzentrationsschwierigkeiten – oder steckt möglicherweise ADHS dahinter?
Konzentrationsprobleme sind vielschichtig – nicht immer steckt ADHS dahinter
Konzentrationsschwierigkeiten können viele Ursachen haben. Sie können Zeichen von Überforderung, Stress, belastenden familiären oder schulischen Situationen, Ängsten oder auch anderen psychischen Problemen sein. Deshalb ist es wichtig, nicht vorschnell auf eine Diagnose zu schließen.
Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort, renommierter Kinder- und Jugendpsychiater, stellt klar:
„Konzentration ist ein komplexer Prozess, der durch viele Faktoren beeinflusst wird. Nicht jede Unaufmerksamkeit ist ADHS – oft stecken ganz andere Belastungen hinter den Symptomen“ (Schulte-Markwort, 2019).
Woran können Sie als Eltern erkennen, ob ADHS vorliegen könnte?
ADHS zeichnet sich meist durch ein typisches Muster aus: Neben Konzentrationsproblemen treten oft auch eine ausgeprägte Impulsivität, motorische Unruhe und Schwierigkeiten im sozialen Miteinander auf. Kinder mit ADHS haben häufig Probleme, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit bewusst zu steuern, und zeigen deutlich mehr Verhaltensauffälligkeiten als bei „normalen“ Konzentrationsphasen.
Die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP) betont deshalb:
„Eine sorgfältige und umfassende Diagnostik ist notwendig, um ADHS von anderen Ursachen abzugrenzen und den passenden Unterstützungsweg zu finden“ (DGKJP, 2018).
Was können Sie als Eltern tun?
Beobachten Sie Ihr Kind aufmerksam und notieren Sie, wann und in welchen Situationen die Konzentrationsprobleme besonders stark sind. Achtung: Konzentrationsprobleme, die nur in bestimmten Situationen auftauchen (z. B. nur in der Schule oder wenn Stress besteht), können ein Hinweis auf äußere Belastungen oder Lernschwierigkeiten sein.
Versuchen Sie, Ihrem Kind einen strukturierten Tagesablauf mit festen Pausen, Rituale und eine möglichst stressfreie Umgebung zu schaffen. Gleichzeitig sollten Sie auf andere Auffälligkeiten wie starke Impulsivität, häufige Stimmungsschwankungen oder Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen achten.
Wenn Sie unsicher sind oder Ihr Kind über längere Zeit stark belastet ist, zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine fundierte Diagnostik hilft, der Ursache auf den Grund zu gehen – egal ob ADHS oder andere Belastungen.
Russell A. Barkley, Experte auf dem Gebiet ADHS, fasst zusammen:
„Frühzeitige und umfassende Hilfe kann den weiteren Entwicklungsverlauf eines Kindes entscheidend verbessern“ (Barkley, 2014).
Fazit:
Konzentrationsprobleme bei Kindern und Jugendlichen können viele Ursachen haben – ADHS ist nur eine mögliche Diagnose. Für Eltern ist es wichtig, aufmerksam zu beobachten, ob zusätzlich andere Symptome auftreten, die auf ADHS hinweisen, oder ob äußere Belastungen im Spiel sind. Eine professionelle Abklärung bietet die Klarheit, die Sie brauchen, um Ihrem Kind gezielt zu helfen.
Sie wünschen sich Unterstützung?
Als erfahrene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit psychodynamischem Schwerpunkt begleite ich Familien einfühlsam bei der Abklärung von ADHS und anderen Ursachen von Konzentrationsproblemen. Gemeinsam finden wir heraus, was hinter dem Verhalten Ihres Kindes steckt, und entwickeln einen individuellen Weg, der Ihr Kind stärkt.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf – ich freue mich, Sie und Ihr Kind zu unterstützen.
Herzlichst,
E. Salmaier
Quellen:
- Schulte-Markwort, M. (2019). Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Springer-Verlag.
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) (2018). Leitlinie ADHS bei Kindern und Jugendlichen.
- Barkley, R. A. (2014). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. Guilford Press.
Stimmungsschwankung oder Depression? Orientierung für Eltern in der Pubertät
Die Pubertät ist bekanntlich eine Zeit großer Veränderungen und Herausforderungen – sowohl für Jugendliche als auch für ihre Eltern. Viele Mütter und Väter fragen sich: Wie erkenne ich, ob mein Kind „nur“ mitten in der Pubertät steckt oder ob Anzeichen für eine Depression vorliegen? Die richtige Einschätzung ist wichtig, um Unterstützung anbieten zu können.
Pubertät: Wenn Stimmungen schwanken und das Leben Kopf steht
Jugendliche erleben in dieser Phase oft:
- Stimmungsschwankungen – mal himmelhochjauchzend, mal zutiefst betrübt
- Rückzug, Reizbarkeit und Unsicherheit
- Fragen zu Sinn, Identität und Selbstwertgefühl
Wie Prof. Carola Bindt (2021) von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf betont: „Es gehört durchaus zum Jugendalter dazu, mal traurig zu sein, Selbstzweifel zu haben und den Sinn des eigenen Daseins infrage zu stellen“ (Bindt, 2021, S. 34). Solche Stimmungen sind meist vorübergehend. Erst wenn sie sich über Wochen halten oder der Alltag massiv beeinträchtigt ist, sollten Eltern genauer hinschauen.
Depression: Wenn die Belastung zu groß wird
Depressive Störungen sind im Jugendalter keine Seltenheit – sie unterscheiden sich jedoch von typischen Stimmungstiefs. Warnzeichen sind zum Beispiel:
- Anhaltende Traurigkeit oder Leere
- Wenig Freude an sonst beliebten Aktivitäten
- Starke Erschöpfung, Schlafstörungen
- Selbstvorwürfe und Hoffnungslosigkeit
- Rückzug von Freunden und Familie, Leistungsabfall
Aktuelle Studien zeigen: „Depressive Störungen treten vor allem in der Pubertät erstmalig gehäuft auf und unterscheiden sich von normalen Stimmungsschwankungen deutlich“ (Banaschewski & Hölter, 2022, S. 112). Besonders wichtig: Jugendliche zeigen Depression oft anders als Erwachsene – zum Beispiel durch Reizbarkeit statt durch offensichtliche Traurigkeit.
Warum kommt es zur Depression? Einblick aus psychodynamischer Sicht
Depressionen entstehen meist durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren:
- Belastende Erlebnisse in Familie oder Schule
- Soziale Konflikte und hoher Leistungsdruck
- Genetische und biologische Einflüsse
Aus psychodynamischer Sicht können ungelöste innere Konflikte, etwa um Selbstwert, Zugehörigkeit und Unabhängigkeit, eine Rolle spielen. „Gerade in der Identitätsfindung der Adoleszenz werden emotionale Verletzlichkeiten und Konflikte deutlich, die das Risiko für depressive Entwicklungen erhöhen können“ (Ermann & Rohde, 2019, S. 56).
Was sollten Eltern beachten?
Achten Sie besonders darauf, wenn
- sich Symptome über mehrere Wochen nicht bessern
- Ihr Kind sich extrem zurückzieht oder Interessen verliert
- Suizidgedanken, Selbstverletzungen oder eine tiefe Hoffnungslosigkeit auftreten
Hier ist es wichtig, nicht zu urteilen, sondern offen zu sprechen und bei Unsicherheit fachlichen Rat einzuholen. Studien belegen: „Gut informierte Eltern können maßgeblich dazu beitragen, dass Jugendliche rechtzeitig die passende Hilfe bekommen“ (Fegert et al., 2020, S. 221).
Praktische Tipps für den Alltag
- Beobachten Sie Veränderungen aufmerksam, aber ohne Vorwürfe
- Suchen Sie das Gespräch in ruhiger Atmosphäre und zeigen Sie Verständnis
- Kontaktieren Sie Fachleute (Hausarzt, Schulpsychologe, Psychotherapeut), wenn Sie unsicher sind
Fazit
Stimmungsschwankungen gehören zur Pubertät, aber anhaltende Hoffnungslosigkeit, Rückzug und Interessenverlust sollten Eltern ernst nehmen. Je früher Sie Unterstützung suchen, desto besser kann Ihrem Kind geholfen werden. Sie sind damit ein wichtiger Anker auf diesem manchmal stürmischen Weg ins Erwachsenenleben.
Eltern müssen nicht alles allein stemmen
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind über einen längeren Zeitraum leidet oder die Situation Sie verunsichert, holen Sie sich Unterstützung. Oft hilft schon ein beratendes Gespräch, Sorgen zu sortieren und weitere Schritte gemeinsam zu planen. In meiner Privatpraxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bin ich gerne für Sie und Ihr Kind da. Zusammen finden wir heraus, wie es Ihrem Kind geht und welche Form der Hilfe am sinnvollsten ist. Sie können sich jederzeit – auch bei Unsicherheiten – vertrauensvoll an mich wenden.
Herzlichst,
E. Salmaier
Quellenverzeichnis
- Banaschewski, T., & Hölter, S. M. (2022). Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. In K. Henningsen & H. Remschmidt (Hrsg.), Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters (8. Aufl., S. 110–128). Springer.
- Bindt, C. (2021). Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter erkennen. In A. Becker-Stoll & S. Schnabel (Hrsg.), Entwicklung begleiten (S. 33–41). Beltz.
- Ermann, M., & Rohde, A. (2019). Lehrbuch der Psychodynamik: Psychische Störungen aus psychoanalytischer Sicht (5. Aufl.). Kohlhammer.
- Fegert, J. M., Berthold, O., & Clemens, V. (2020). Depressionen im Jugendalter – Erkennbarkeit und Prävention. Deutsches Ärzteblatt, 117(14–15), 220–225.
